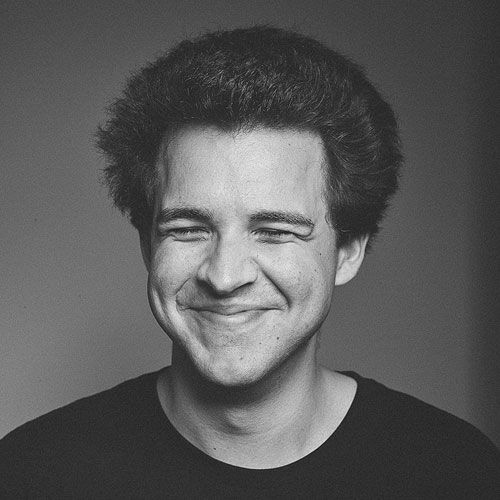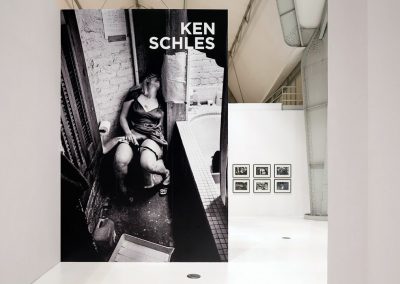„Wir möchten die Menschlichkeit in der Fotografie zurückholen“ Sebastian Gansrigler im Interview mit Christian Reister

Christian Reister: Im März erscheint die erste Ausgabe des Magazins „Auslöser“. Braucht die Welt tatsächlich noch ein neues Fotomagazin?
Sebastian Gansrigler: Ich denke es gibt momentan genug Medien am Markt, die sich auf einer technischen und oberflächlichen Weise mit Fotografie auseinandersetzen. Also so gesehen braucht die Welt wirklich kein neues Fotomagazin. Was wir mit dem Auslöser erreichen möchten, ist die Menschlichkeit in der Fotografie zurückzuholen, die Fotografie allgemein zu entschleunigen und wirklich diese wundervollen, persönlichen Geschichten hinter den Fotos zu erzählen. Das machen sehr wenige Magazine und können auch nur wenige, und wenn dann nur in einer sehr kurzen, reduzierten Form. Das ganze Projekt hat natürlich auch alles viel mit Zeitlosigkeit zu tun. Wir bringen keine Ausstellungsnews und berichten auch nicht über die neueste Kamera und wie viele Megapixel die hat. Wir versuchen da wirklich in die Tiefe zu gehen und alles zu hinterfragen, Traditionen aufzubrechen und in einer verstaubten Medienlandschaft etwas Lebendiges, Frisches durchzusetzen.
Christian Reister: Wer ist „wir“?
Sebastian Gansrigler: Ich bin selbst Fotograf und medienübergreifend, von Webdesign bis Print, unterwegs. Arbeite hauptsächlich für Museen und Galerien in Wien, aber auch sehr gemischt Aufträge für verschiedenste Firmen. Durch den Auslöser kann ich alle diese Bereiche verbinden, was wirklich viel Spaß macht. Und dazu habe ich für den Auslöser ein kleines Team aufgebaut. Ich wollte nicht, dass die Ansichten und Aussagen alle nur an mir hängen und von mir kommen.
Mit Kay von Aspern und Niko Havranek mache ich die Auswahl und Zusammenstellung der FotografInnen, das ist schon ein langer Rechercheprozess für jede Ausgabe. Wir stellen den Inhalt sehr kontrastreich zusammen und haben kein Thema und keine Kategorien. Kay und Niko sind beide großartige Fotografen, die sich in dem Bereich auch richtig auskennen und sich damit intensiv beschäftigen. Martina Schreiner übernimmt das Marketing, Social Media und Eventplanung. Meine Schwester, Veronika Gansrigler, macht das Lektorat und die Übersetzung von Deutsch zu Englisch bzw. Englisch zu Deutsch. Das sind auch wieder zwei große Bereiche, die sehr wichtig sind. Im Grunde ist der Auslöser jetzt von einer kleinen Idee zu einem großen Team- und Communityprojekt gewachsen. Eigentlich verrückt und ich versuche das selbst noch alles zu realisieren. Das ging alles sehr schnell.
Christian Reister: Ein Verlag steht also nicht dahinter, viel mehr ein Team aus Wiener Enthusiasten.
Sebastian Gansrigler: Ja, genau.
Christian Reister: Wie finanziert ihr den Auslöser und wie wird er vertrieben?
Sebastian Gansrigler: Es war von Anfang wichtig, dass das ein unabhängiges Magazin werden soll. Natürlich, ganz unabhängig ist nie etwas. Wir sind sehr dankbar, dass wir ein paar Firmen gefunden haben, die uns finanziell unterstützen können. Die Druckkosten sind doch recht hoch. So eine sehr positive Rückmeldung habe ich mir anfangs gar nicht erwartet. Zu der Zeit war das Magazin ja noch gar nicht am Markt, trotzdem haben wir schon großartige Partner und Supporter wie z.B. in Wien das WestLicht, Kunstforum, Kunsthalle, Secession gewinnen können, die uns auch dieses Vertrauen geschenkt haben. Teilweise sind da auch größere Kooperationen geplant und teilweise sind das reine Anzeigenplatzierungen im Magazin. Also es gibt durchaus Werbung in jeder Ausgabe. Die ist sehr reduziert und einheitlich mit einem Logo gestaltet. Das fällt fast nicht als Werbung auf, weil sie sich so schön und harmonisch in das Layout einfügt. Das hat eine Zeit gedauert bis das überhaupt verstanden wurde und angekommen ist, ich glaube das ist ein sehr neues Konzept. Aber einige Indie Magazine machen das so, finde ich richtig großartig. Man liest die Werbung dann sogar gerne. Mit dem Auslöser haben wir da echt jetzt sehr viel Kontrolle über die Gesamtgestaltung, das ist weit entfernt von selbstverständlich. Wenn bei einem gedruckten Magazin schon die ersten 12 Seiten mit kunterbunter Werbung vollgestopft sind, mache ich das meistens gleich wieder zu. Da vergeht mir die Lust am Lesen.
Den Vertrieb machen wir auch selbst, über unseren Onlineshop. Wir bringen jede Bestellung selbst händisch zur Post und jede/r BestellerIn bekommt eine persönliche Notiz dazu. Immer wenn ich jetzt über den Onlineshop eine neue Vorbestellung sehe, bin ich total aufgeregt und freue mich riesig und muss gleich nachschauen, woher die Person kommt und was die macht. Das wäre bei einem großen Verlag oder Vertriebspartner gar nicht möglich. Da würde mir die persönliche Verbindung zum/r LeserIn fehlen. Wir beliefern dann auch einige ausgewählte Buchhandlungen, Galerien, Museums- und Magazinshops für den Anfang in Österreich und Deutschland, wo man den Auslöser dann auch einfach physisch ansehen und kaufen kann. In Berlin und München gibt es großartige, die speziell nur Indie Magazine verkaufen. Das ist eine sehr schöne Szene.
Christian Reister: Kommen wir zum Inhalt der ersten Ausgabe. Ihr habt vier recht unterschiedliche Fotograf*innen
im Heft, mit denen ihr Interviews geführt habt. Diese Interviews erscheinen im Heft zusammen mit Fotografien der Interviewten und haben eine Länge, die weit über den üblichen Rahmen hinausgehen.
Sebastian Gansrigler: Ja, das sind wirklich Langforminterviews. Jede/r FotografIn bekommt 26 bis 30 Seiten im Magazin. Das ist so toll, weil man dadurch wirklich in die Materie, Arbeit und Persönlichkeit eintauchen kann. Ich habe jetzt selbst durch diese Gespräche extrem viel gelernt. Das kann man gar nicht mit dem Lernstoff eines Workshops, einer Fotoschule oder Universität vergleichen. Das ist viel intensiver, was wir hier versuchen.
Christian Reister: Nach welchen Kriterien seid ihr bei der Auswahl vorgegangen?
Sebastian Gansrigler: Zur Auswahl des Inhalts fließen viele verschiedene Kriterien mit rein. Da wir keine Themenvorgaben haben, stellen wir die FotografInnen so unterschiedlich wie nur möglich zusammen. Wir mischen das auch bunt durch, was das Alter, die Herkunft, die Sprache, die Fototechnik, den Stil und den Bekanntheitsgrad betrifft. Wir setzen berühmte FotografInnen neben sehr unbekannte, sehr junge neben ältere. Dadurch entsteht ein sehr spannender Kontrast und sehr unterschiedliche Ansichten. Wir beleuchten dadurch die Fotografie aus vielen verschiedenen Perspektiven und zeigen, wie breit gefächert sie sein kann.
Wichtig ist uns, dass wir pro Ausgabe immer zwei Frauen und zwei Männer zeigen. Ich denke, dass in der Fotografieszene und generell noch immer eine größere Repräsentation von Frauen und deren Arbeiten fehlt. Gegen genau das kämpfen wir auch an. Abgesehen davon, suchen wir in erster Linien nach guten Geschichten, nicht nur guten Fotos. Der/die FotografIn muss einen bestimmten, bewussten Zugang und Reflektion über die eigene Arbeit haben. Das ist natürlich bei manchen mehr, bei anderen weniger der Fall.
Christian Reister: Wie wurden die Interviews geführt? Klassisch bei einem persönlichen Treffen oder per Email-Ping-Pong, so wie wir das gerade tun?
Sebastian Gansrigler: Unterschiedlich. Immer was zeitlich oder auf Grund der Location möglich ist. Wolfgang Zurborn, der in Köln lebt, konnten wir in Salzburg persönlich treffen. Er hat dort im Fotohof gerade sein neues Buch „Karma Driver“ vorgestellt und davor haben wir das Interview mit ihm gemacht. Das war, glaube ich, sogar das längste Gespräch von den vier. Wolfgang kann sehr gut und sehr genau über seine Arbeiten reden, und auch sehr viel, wir mussten sogar große Teile davon streichen, war sehr schade war, aber wir möchten uns natürlich auf die Essenz und die Kernaussagen fokussieren. Ich habe schon überlegt nach ein paar Jahren dann eine eigene Publikation mit den Outtakes zu machen. Das wäre sicher lustig.
Friedl Kubelka hat ihr Atelier in Wien, wir konnten sie auch persönlich treffen. Ich war jetzt sogar schon zweimal bei ihr und jedes Mal entstehen sehr schöne Gespräche. Es ist sehr unterschiedlich wie jede Person auf die Interviewfragen reagiert und antwortet. Manche introvertiert und man muss das Interview mehr lenken, andere weniger und der Redefluss entsteht von selbst. Bei unserer Recherche notieren wir viele Fragen, aber beim tatsächlichen Interview entstehen oft ganz andere Dinge, die wir vorher gar nicht absehen oder einplanen konnten, da sind wir dann auch flexibel und passen die Fragen an. Wir möchten die Gespräche auf jeden Fall als natürlich und sehr flüssig zeigen.
Mit Yanina Boldyreva und Brian Finke war das etwas schwieriger. Yanina lebt in Novosibirsk, im tiefsten Russland. Ich wäre sogar gerne hingereist, aber das Reisebudget reicht noch nicht ganz aus. Mit ihr haben wir das Interview schriftlich über Skype gemacht und es wurde sehr spannend, obwohl sie viel besser Russisch als Englisch spricht und schreibt. Mir ist dann im Nachhinein bei der Übersetzung ins Deutsche und der Korrektur des englischen Textes vieles noch klarer geworden. Die Sprache und Kommunikationseinschränkungen darf man nicht vergessen, habe ich unterschätzt. Mit Brian Finke, aus New York, war das Interview verbal über Skype und eher kürzer und auf den Punkt gebracht. Ich denke, man merkt auch sofort wenn jemand schon öfters Interviews gegeben hat.
Christian Reister: Wer führt die Interviews? Habt ihr verschiedene Autoren?
Sebastian Gansrigler: Bis jetzt waren drei von mir geführt und eines gemeinsam mit Niko. Die Fragen recherchieren wir alle gemeinsam. Ich glaube im Laufe der nächsten Ausgaben werden wir das alles erst herausfinden, wie das am besten funktioniert. Wir sind keine Journalisten und keine Kunsthistoriker, es kommt alles aus einer persönlichen Perspektive. Erst viel später im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass das Interview, welches ein bis zwei Stunden dauert, die wichtigste Zeit des ganzen Projektes ist. Das ist der kürzeste Teil von allem, aber genau dieses Teil ist der wichtigste. Da wird man bisschen verrückt wenn man sich das kurz vor dem Treffen durch den Kopf gehen lässt.
Christian Reister: Neben den Interviews mit den Fotografen habt ihr auch eine Geschichte über Steidl im Heft. Wie war’s in Göttingen? War es einfach, als vollkommen neues Magazin in die heiligen Hallen der Druckerei zu kommen?
Sebastian Gansrigler: Ich war extrem überrascht, dass wir überhaupt eine Antwort, und dann sogar eine Einladung bekommen haben. Ich hatte einfach per E-Mail zweimal angefragt ob wir ein Interview machen dürften und das Konzept zum Magazin auf 12 Seiten dazugeschickt. Genau wie Friedl Kubelka gibt auch Steidl sehr wenige, nur speziell ausgewählte, Interviews, was mir stark bewusst war. Den Film „How to make a book with Steidl“ habe ich oft gesehen, der ist auch bekannt und die Reportage im New Yorker über ihn fand ich auch großartig.
Gerhard Steidl persönlich hat mich dann an einem Sonntag zu Mittag angerufen. Ich war am Telefon etwas mehr als verblüfft. Den Termin zum Besuch haben wir dann zwei Monate im Voraus ausgemacht. Wie wir dann dort in Göttingen waren, war das wie eine andere Dimension, die man betritt. Sie nennen das nicht ohne Grund „Steidlville“. Es ist alles perfekt geplant und durchdacht. Jeder einzelne Produktionsschritt von jedem Buch wird von Gerhard Steidl persönlich kontrolliert. Wir haben am Anfang eine lange Tour durch alle Gebäude und alles genau erklärt bekommen und durften alles fotografieren. Wir haben sogar einen Schlüssel bekommen und durften jederzeit überall hinein. Eine extrem sympathische, freundliche Stimmung liegt in der Luft. Es hat doch alles eine gewisse Strenge, aber dadurch erzielt man wohl diese hohe Qualität, wofür Steidl so bekannt ist. In Göttingen haben wir übernachtet und den nächsten Tag auch noch bei Steidl verbracht. Um fünf Uhr Früh waren wir dabei wie Herr Steidl die Druckerei, was er jeden Morgen macht, aufsperrt. Später kommen dann die Mitarbeiter nach und nach. Wir besuchten sogar sein Privathaus und Archiv. Wer ein Steidl Buch kennt, kennt auch diesen bestimmten Papiergeruch. Der ist auch überall in der Druckerei präsent. Man merkt, dass das eine Kultur ist, die sich um die Kunst herum bewegt, um die Liebe zur Fotografie, zum Papier und zum Handwerk. So etwas ist ganz besonders
und extrem selten.
Zum Abschied haben wir noch eine große Tasche an Steidl Büchern und Katalogen erhalten. Es war eine sehr surreale Reise, ein wunderschöner, herzlicher Aufenthalt mit vielen spannenden Gesprächen. Eine sehr besondere Erfahrung. Ich musste mich noch ein paar Tage später davon „erholen“. Im Auslöser zeigen wir davon viele Zitate begleitet von einer langen Fotostrecke.
Christian Reister: Letztlich gibt es dann auch noch ein wenig Kameratechnik im Heft.
Sebastian Gansrigler: Wir zeigen pro Ausgabe eine Kamera im Detail, aber da geht es gar nicht um die Technik, sondern mehr um die Ästhetik des Objekts und die Geschichte dahinter. Von den meisten Magazinen wird die Kamera immer rein technisch beschrieben, was sie aber ja nicht ist. Natürlich ist sie ein Werkzeug, genau wie für einen Tischler der Hammer und der Nagel. Aber diese Objekte haben noch ganz andere Seiten. Wir behandeln das fast so, als wäre die Kamera ein Mensch, der uns eine Geschichte erzählt, als würden wir ein Interview mit der Kamera führen.
In der ersten Ausgabe zeigen wir Susse Frères Daguerréotype, die erste kommerziell hergestellte Kamera der Welt, und die Letzte ihrer Art, die noch existiert. Dazu haben wir eine tolle Kooperation mit dem WestLicht Kameramuseum in Wien gemacht. Die Kamera ist dort im Schaudepot ausgestellt, wir durften sie herausnehmen und in unserem bestimmten Studiosetup ausleuchten. Sie feiert mit uns heuer 180 Jahre Fotografie und somit die Erfindung und Gründung des fotografischen Verfahrens, wie wir es heute kennen. Ich denke, das ist super passend für die erste Auslöser Ausgabe, auch wenn wir vom „Auslösen“ ansich sprechen.
Christian Reister: Ist zur Veröffentlichung der ersten Nummer ein Event geplant?
Sebastian Gansrigler: Da bin ich schon sehr aufgeregt. Das ist am 7. März 2019 von 18:00 bis 22:00 im VIU Store Neubaugasse in Wien. Wir werden dort eine große Magazin Release Party feiern und den Auslöser präsentieren. Es gibt Goodie Bags, Poster, Getränke und gute Musik. Ich hoffe, dass der Auslöser dadurch auch etwas beworben wird, da es ja um die Unterstützung der Community und FotografInnenszene durch diese Geschichten geht. Und diese Geschichten wollen wir verbreiten und weitererzählen. Ich freue mich schon sehr auf mehr Feedback.
Christian Reister: Gibt es schon konkrete Pläne für die zweite Ausgabe?
Sebastian Gansrigler: Wir recherchieren schon intensiv und möchten mit der zweiten Ausgabe noch verrückter und mutiger werden. Ich hoffe die Leute sehen in welche Richtung wir mit dem Auslöser mit der ersten Ausgabe gehen und diese Richtung wollen wir vertiefen und noch weiter ausbauen. Die Fotografie hat so viel zu bieten, da gibt es endlos viel Material und die Selektion und Zusammenstellung ist schwierig und spannend.
Christian Reister: Gibt es eine Art Traum-Interviewpartner, die oder den du früher oder später interviewen möchtest?
Sebastian Gansrigler: Ich denke, dass es sehr viele Traum-Interviewpartner gibt. Gerhard Steidl war ganz weit oben auf der Liste. Eine Person in der Schweiz habe ich auch interviewt, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Generell denke ich aber, dass man sich vom Status und Bekanntheitsgrad nicht ablenken lassen sollte. Ich glaube eher, dass das Entdecken des Unbekannten viel mehr Spaß macht. Und auf Langzeit gesehen, dass dadurch viel schöne Beziehungen und Freundschaften wachsen können.
Obst und Muse ist auch eine große Inspiration für den Auslöser und ich finde sehr schön was ihr macht. Ich möchte dir herzlich danken für das Interview!
Christian Reister: Mein Dank zurück und viel Erfolg mit dem Auslöser!
Sebastian Gransrigler, *1994, ist Herausgeber des neuen Fotomagazins Auslöser. Er arbeitet als unabhängiger Fotograf und Grafikdesigner für Museen und Galerien in Wien.